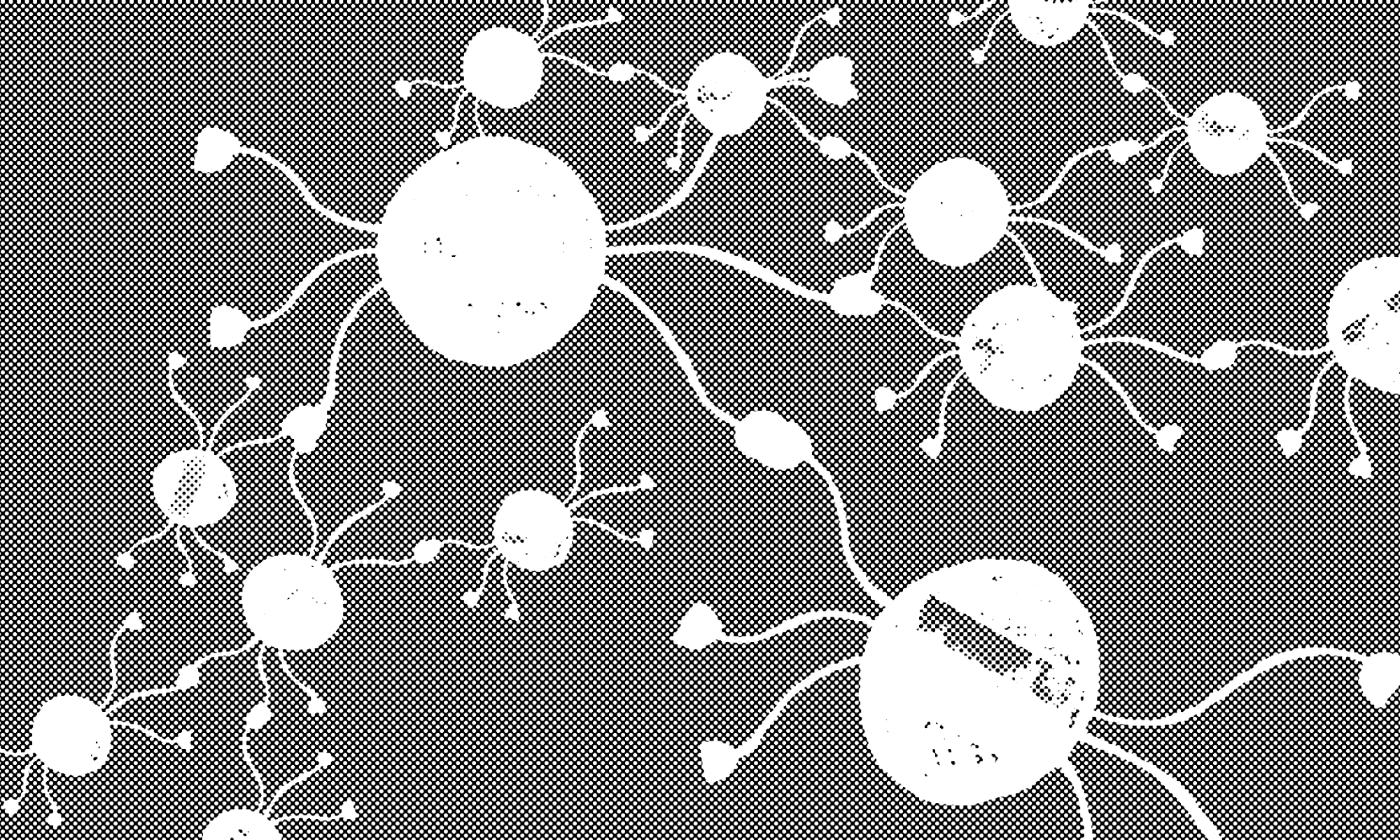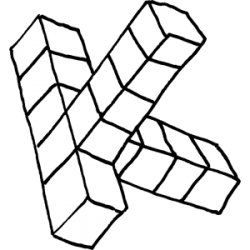Thessaloniki, 31. Mai 2012
Viel zu lange war ich eitel. Ich war unsicher und es war mir wichtig, wie andere mich sehen. Ich habe Freunde um mich versammelt, die meine Eitelkeiten pflegten. Leute, die mir sagten, was meine Eitelkeit hören wollte. Doch diese Freunde waren selbst eitel und im Austausch musste ich ihnen geben, was ihre Eitelkeit hören wollte.
Wir waren wie voneinander abhängig.
Doch dann wurde ich der Eitelkeit überdrüssig. Ich bemerkte die Energie, die es kostet, die Eitelkeit zu pflegen und wie es mich abhielt, mutig zu sein. Zu sagen, was man denkt, zu tuen, was man fühlt. Denn was könnten die anderen denken? Wer eitel ist, hat in Wirklichkeit Angst, von den anderen als das gesehen zu werden, was man selbst befürchtet zu sein: Nichts. Staub der Geschichte. Unbedeutend. Nicht der Rede wert.
Dann habe ich erkannt, dass ich genau das bin: Nichts, unbedeutend, nicht der Rede wert. Und plötzlich konnte ich sagen, was ich denke, tuen was ich fühle. Und es war ganz einfach und es wurde immer einfacher, denn ich musste nicht mehr darauf achten, was die Anderen denken, wie die Anderen mich sehen.
Eine Zeit lang habe ich noch die Eitelkeit meiner Freunde gefüttert. Bis ich spürte, wie viel Energie mir das nahm. Statt für meine Gedanken habe ich für ihre Gedanken gearbeitet. Eitle Gedanken, hohle Gedanken die zu nichts anderem gut waren, als Eitelkeit zu befördern.
Es tut weh, mit Freunden zu brechen. Und es macht Angst. Denn jenseits der Eitelkeit ist da auch die Sorge, alleine zu sein. Der Bruch kam abrupt. Denn die Freunde bekamen schon eine Weile nicht mehr das, was sie brauchten. Und so verlor ich viele Freunde auf einmal.
Und das war gut. Ich verlor nicht alle Freunde. Ein paar wenige blieben. Es blieben die, die nicht aus Eitelkeit mit mir befreundet waren. Und ich lernte, dass ich gar keine eitlen Freunde will. Eitle Freunde sind Zeit- und Energieverschwendung. Was man von eitlen Freunden bekommt glitzert, doch es ist schal und in Wahrheit nichts wert. Nichts, was man will und nichts, wofür man Energie aufwenden sollte.
Und ich habe gelernt. Lieber als eitle Freunde habe ich gar keine Freunde. Lieber als eitel zu sein bin ich nichts, unbedeutend, nicht der Rede wert.