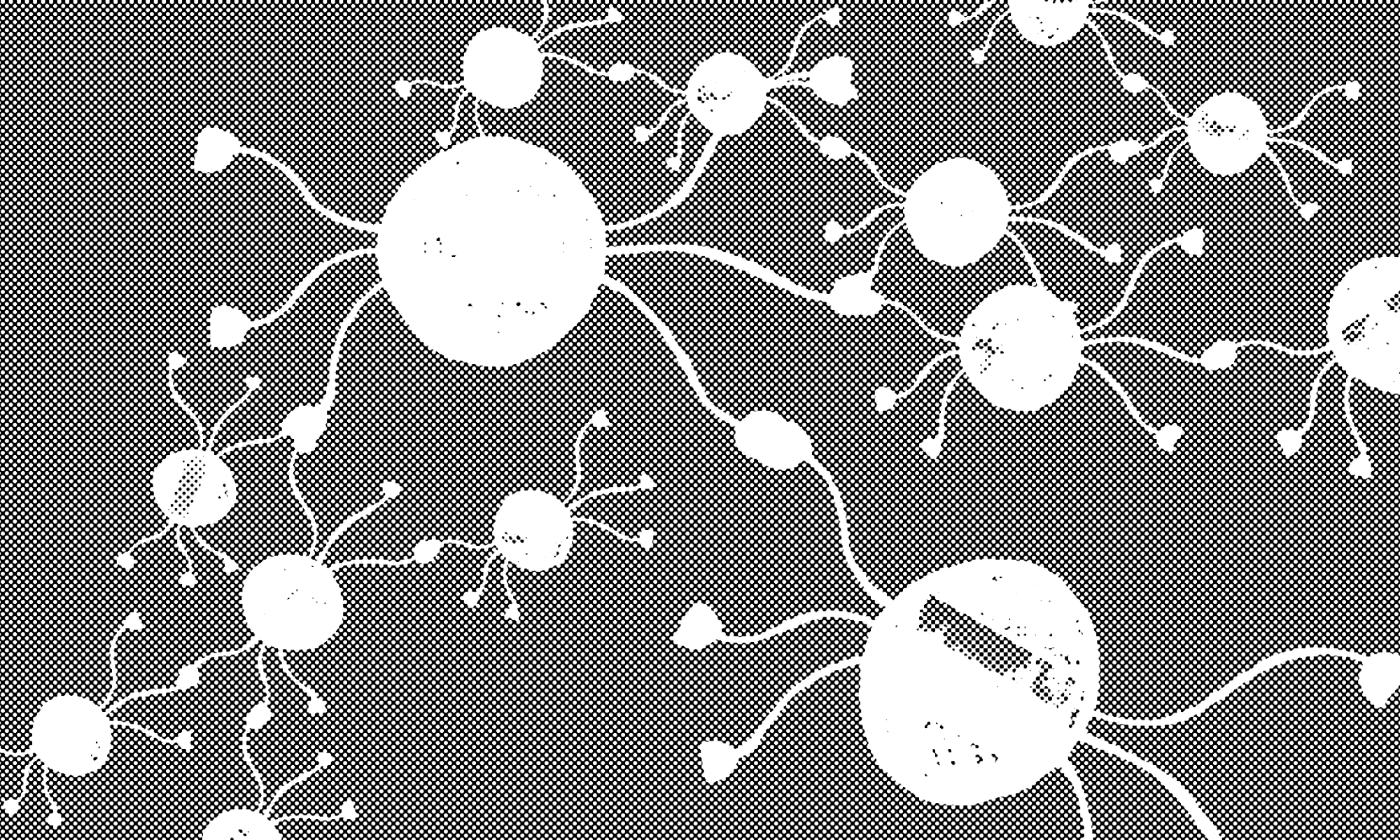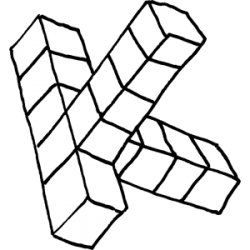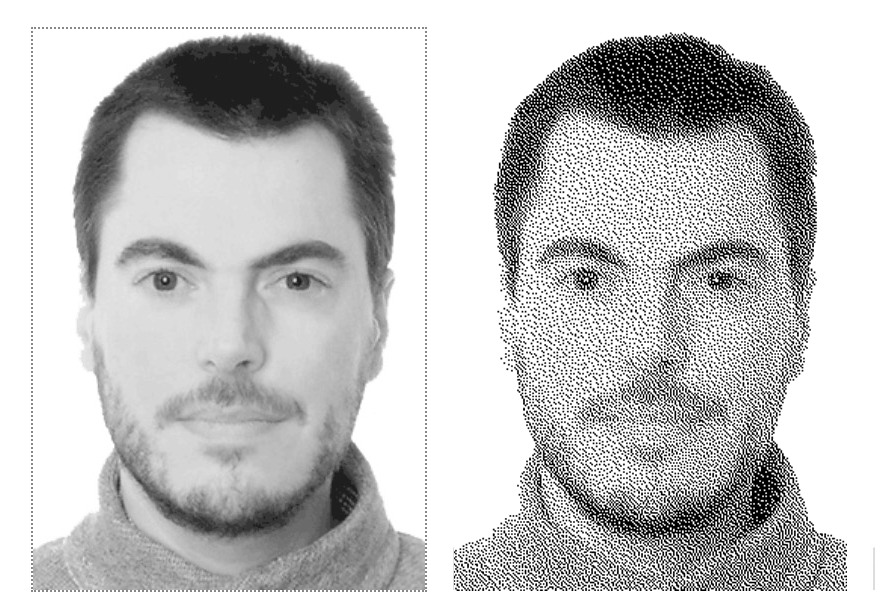Gerade bin ich zufällig auf ein 10 Jahre altes Interview gestoßen, dass ich, nachdem ich es damals pflichtbewußt (die Dokumentation nimmt der Künstler ernst) auf YouTube geladen hatte und danach vergaß. Ich wusste damals schon, dass sich für dieses Video kaum jemand interessieren würde, und so war es dann ja auch. Und irgendwie war mir das Video auch ein wenig unangenehm, weil ich blöd aussah und vor allem, weil ich es wieder nicht hinbekommen hatte dieses seltsame Ding zu erklären, das an sich so simple ist, viel simpler jedenfalls als der Quatsch, mit dem sich die Leute das Leben versauten. Ausserdem sah es uncool aus, dieses klischeehafte auf Fernsehen gemachte Studio, in dem ich jedem unerträglich gschaftelhuberisch rüberkommen musst, der nicht kapierte, über was um himmels Willen ich da redete. Und so richtig kapiert, worüber ich da geredet habe hat es (ich dramatisiere) wohl nur ein Mensch auf der Welt und das war ich.
Ich verstehe immer noch, was ich sagen wollte. Es ist alles richtig. Nur wenn ich meine Meinung zum besten gebe, und über irgendwas spreche, was dieses Ding nicht war (über Film, Innovation, Akademie), da redete ich Unsinn, aber das waren ja auch alles Bereiche, in denen ich mich nicht auskannte. Aber alles was ich über dieses Software-Ding zu sagen hatte Hand und Fuß. Das kann ich heute mit größerer Autorität sagen, nachdem ich mir über dieses Ding nun weitere 10 Jahre lang den Kopf zerbrochen habe.
Davor war ich Filmemacher, aber ich habe mit dem Filmemachen so gut wie aufgehört weil es mehr Spass machte darüber nachzudenken, was dieses Software-Ding ist, dieses “tool for thought” (Aston 2016, Wiehl 2016, Rheingold 2000), bei dem sich die Gelehrten darüber streiten, wer auf diesen Begriff in diesem Zusammenhang als erster gekommen ist. Bitcoin ist ein “Tool for Thought”, das versteht jeder Bitcoiner sofort; YouTube ist ein “Tool for Thought”, das versteht jeder, der YouTube vollumfänglich nutzt, das Internet ist ein “Tool for Thought”, das versteht jeder, der sich selbst beim Denken beobachtet; Film ist ein “Tool for Thought”, Kino, Podcasts, die Liste liesse sich verlängern, so lange bis alle Erfindungen der Menschheitsgeschichte aufgelistet sind. So weit wollen wir nicht gehen. Man sieht, ich verzettle mich auch heute noch oft, komme vom 100sten ins 1000ste, weil alles mit allem verknüpft ist, verstehen Sie, jetzt, worauf ich hinaus will?
😉