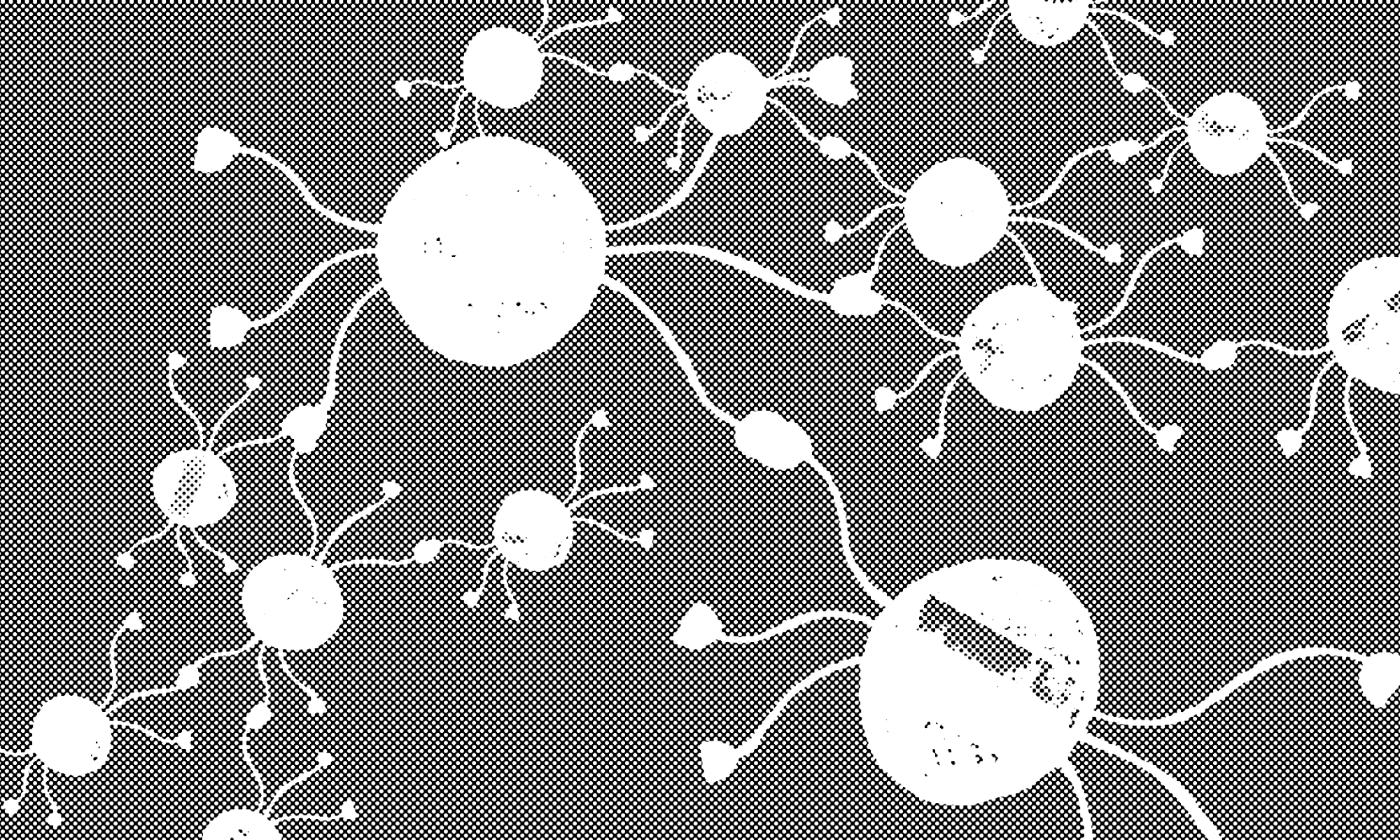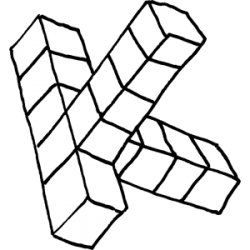Seit ich gelernt habe, richtig zu lesen, hat sich etwas verändert. Es ist eine Veränderung, die mein Leben verbessert.
Den Trick habe ich vor einem Jahr beschrieben. Der kurze Text endet mit folgendem:
Ich habe auch gelernt zu denken. Meinem Denken zu vertrauen, mein Hirn zu benutzen. Die Bücher sind dadurch viel besser geworden.
Ein Jahr später kann ich sagen, dass nicht nur Bücher besser wurden, auch Gespräche. Und dass andere Meinungen spannender geworden sind. Früher empfand ich es oft als ärgerlich, wenn jemand etwas anders gesehen hat, als ich – jetzt sehe ich es fast durchweg als Bereicherung. Schon jetzt merke ich, wie mein Leben dadurch friedvoller und gleichzeitig vielschichtiger wird. Und obendrein lerne ich, mein eigenes Denken besser verstehen. Wenn man keine Angst hat, den Kopf kurz unter Wasser zu tauchen, kann man viel entspannter schwimmen.
Wie wurde dieses Wunder möglich? Ich habe mit dem neuen Lesen immer wieder geübt, mir eine kurze Pause im Fluss des Lesens zu nehmen. In diesen Pausen bin ich dann meinen eigenen Gedanken gefolgt, ohne Sorge, Zeit zu verschwenden und vom Thema abzukommen. Und so lernte ich, das, was ich gerade gelesen hatte, in Ruhe zu betrachten und zu bedenken. In der Folge stellte ich immer öfter fest, dass ich anderer Meinung bin, als der Autor. Immer wieder passierte es, dass ich sah, an welchen Stellen dem Autor ein Denkfehler, eine Unachtsamkeit unterlaufen war. Bevor ich das richtige Lesen lernte, habe ich mir nicht die Zeit genommen, anzuhalten, zu betrachten, nachzudenken. Ich habe dem Autor geglaubt, oder ich habe ihm nicht geglaubt. Auch bei einer Kleinigkeit, wenn ich dem Autor nicht glaubte, habe ich das Buch angelesen zur Seite gelegt und nie mehr hinein geschaut. Heute bin ich dem Autor für kleine Ungenauigkeiten dankbar – sie schärfen meinen Blick.
Wenn ich früher in einem Gespräch anderer Meinung war, habe ich versucht, mein Gegenüber zu überzeugen. Das hat mich gestresst und es hat die Person genervt. Gelernt haben wir beide nichts.
Jetzt erfahre ich – die Meinungen anderer Menschen, ihre Beobachtungen, können meinen Blick auf Dinge lenken, die ich sonst womöglich übersehen hätte.
Zum Beispiel:
“Diese Kneipe ist Scheiße!” hat ein Bekannter zu mir gesagt, als wir auf einem Geburtstagsumtrunk in einer 15 Jahre alten Berlin-Mitte-Bar standen. Irgendwie mochte ich den Laden auch nicht. Wenn ich das Gespräch entsprechend meinem alten Lesemuster verstanden hätte (Der Autor ist meiner Meinung versus der Autor ist nicht meiner Meinung) hätte ich dem Bekannten wohl recht gegeben, und der weitere Verlauf des Unterhaltung wäre vermutlich keiner weiteren Beschreibung wert gewesen. Doch entsprechend meines neuen Musters nahm ich mir einen Atemzug Zeit, sah mir den Raum an und fragte: “Warum?”
“Diese Bar ist völlig lieblos eingerichtet,” er deutete auf die kahle Betonwand, “das hat alles überhaupt keine Aussage.”
Da hatte mein Bekannter recht. Die Bar wirkte spartanisch, Betonwände, weiße Wände, jedes Ding in diesem Laden betont unaufdringlich. Doch ich verstand, als ich es mir überlegte, was der Gedanke dahinter war: Vor 15 Jahren haben eine Reihe von jungen Architekten, die gerade mit ihrem Studium fertig waren, in Berlin eine Reihe von Clubs und Bars aufgemacht. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt war für junge Architekten damals nicht gerade rosig, sie hatten Zeit an der Hand und Visionen im Kopf. Die Idee dieser Läden war an dem Konzept von White-Cube-Galleries orientiert, die neutrale Orte sein sollten (mit weißen Wänden), um dem Inhalt Raum zu geben, sich ihm unterzuordnen. So wie die Kraft eines Gemäldes in einem Raum mit weißen Wänden völlig anders wirkt, als in einer Barockkirche. Die Kraft des Bildes, so die Theorie der weißen Wände, komme dann aus sich selbst heraus. Vermutlich deshalb standen in der Folge so viele Poser in coolen Mitte-Bars herum, oder vielleicht war es auch so, dass jeder, der in einem derartigen Laden herumhing, wie ein Poser wirkte. Jedenfalls gerieten diese Läden mit der Zeit aus der Mode. Nur wenige gibt es immer noch. Dies ging mir durch den Kopf und erschien mir so viel spannender, als meine Meinung oder die Meinung meines Gegenübers.
Und dann schenke mir mein Gesprächspartner noch einen weitere Beobachtung: “Die Lampe da, ist Scheiße, sie blendet.” Und es war wahr, wenn man direkt in die Lampe blickte, blendete sie unangenehm. Ich nahm mir Zeit und ließ meinen Blich schweifen und war fasziniert von drei Biergläsern, die geradezu wunderhübsch anzusehen waren. Dann merkte ich, dass die Gesichter des Publikums fantastisch ausgeleuchtet waren. Dies war mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewußt geworden und ich war von der Entdeckung geradezu beglückt. Mein Bekannter hatte recht, die Lampe blendete. Aber ein anderer Teil der Realität war eben auch, dass sie die Szene toll ins Licht setzte.
Ich habe Design studiert. An diesem Abend habe ich so viel über Design gelernt, wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Weil ich mich weder von meiner Meinung blenden ließ, noch von der Meinung meines Gegenübers, weil ich mir Zeit nahm zu beobachten und zu bedenken.
Es war der Beginn eines Abends voller Wunder.
–